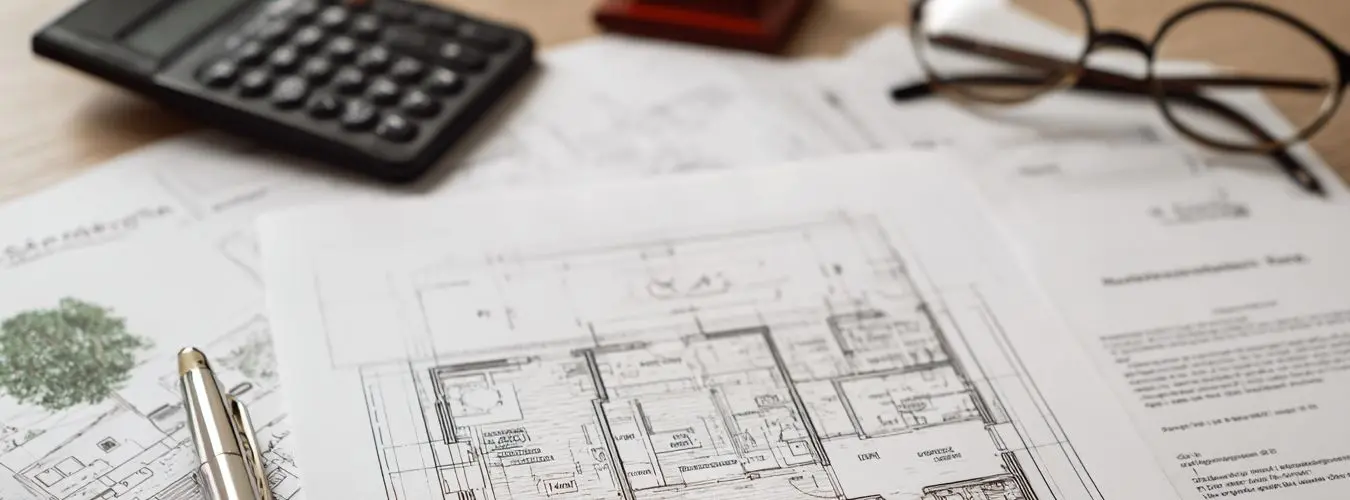Der Kaufpreisfaktor ist eine zentrale Kennzahl der Immobilienbewertung, die das Verhältnis zwischen Kaufpreis und Jahresnettokaltmiete beschreibt.
Formel:
Kaufpreisfaktor = Kaufpreis / Jahresnettokaltmiete
Beispiel:
Ein Haus kostet 1.000.000 €, die Jahresmiete beträgt 50.000 €
→ Kaufpreisfaktor = 20.
Je niedriger der Kaufpreisfaktor, desto schneller amortisiert sich die Investition über die Mieteinnahmen.
Kaufpreisfaktor berechnen – Schritt für Schritt
Formel und Eingangsgrößen
Um den Kaufpreisfaktor einer Immobilie zu berechnen, benötigen Sie:
- Kaufpreis der Immobilie
- Jahresnettokaltmiete
Beispiele aus der Praxis
| Stadt | Objektart | Kaufpreis (€) | Jahresmiete (€) | Kaufpreisfaktor |
|---|---|---|---|---|
| Magdeburg | Mehrfamilienhaus | 1.000.000 | 55.000 | 18,18 |
| Bremen | Gewerbeimmobilie | 2.500.000 | 125.000 | 20,00 |
Der Kaufpreisfaktor Magdeburg liegt bei 18,18, der Kaufpreisfaktor Bremen bei 20. Das zeigt: Regionale Unterschiede und Objektarten haben erheblichen Einfluss auf die Rendite.
Kaufpreisfaktor im Vergleich – Wohnimmobilien vs. Gewerbeimmobilien
| Immobilientyp | Typische Risikofaktoren | Ø Kaufpreisfaktor | Renditeprofil |
|---|---|---|---|
| Wohnimmobilie (z. B. Mehrfamilienhaus) | Geringes Leerstandsrisiko, stabile Mieter | 20–35 | Sicher, aber meist geringere Rendite |
| Gewerbeimmobilie | Höheres Risiko (Mieterbonität, Leerstand) | 15–25 | Höhere Renditechancen, aber volatil |
Kaufpreisfaktor Tabelle – Die 6 größten Städte in Deutschland im Vergleich (Stand 2024/2025)
| Stadt | Ø Kaufpreisfaktor |
|---|---|
| Berlin | 30,74 |
| Hamburg | 35,13 |
| München | 33,75 |
| Köln | 29,94 |
| Frankfurt am Main | 32,79 |
| Stuttgart | 25,36 |
Quelle: empirica-regio (VALUE Marktdaten)
Faktoren, die den Kaufpreisfaktor einer Wohnung beeinflussen
Der Kaufpreisfaktor einer Wohnung wird von mehreren Faktoren beeinflusst, die zusammen den Wert und die Rendite des Objekts bestimmen.
Wichtige Einflussfaktoren
- Lage der Immobilie: Die regionale und mikrolokale Lage ist entscheidend. In stark besiedelten, wirtschaftlich stabilen und gut angebundenen Gebieten ist der Kaufpreisfaktor meist höher als in strukturschwachen Regionen.
- Zustand der Immobilie: Ein guter Zustand erhöht den Kaufpreisfaktor, während ein schlechter oder unsicherer Zustand den Wert senkt, da mehr Risiko und potenzielle Sanierungskosten bestehen.
- Art der Immobilie: Einfamilienhäuser haben meist einen höheren Kaufpreisfaktor als Mehrfamilienhäuser oder Gewerbeimmobilien.
- Makro- und Mikrolage: Neben der allgemeinen Region (Makrolage) spielt auch das direkte Umfeld (Mikrolage) eine Rolle, etwa die Nachbarschaft, Sicherheit, Nahversorgung und Umweltbelastungen.
- Marktbedingungen: Die aktuelle Nachfrage, Zinsentwicklung und allgemeine Wirtschaftslage beeinflussen den Kaufpreisfaktor.
- Mieteinnahmen: Die Höhe der jährlichen Nettokaltmiete ist direkt für die Berechnung des Kaufpreisfaktors relevant. Je höher die Mieteinnahmen, desto niedriger der Kaufpreisfaktor und umgekehrt.
Weitere Aspekte
- Infrastruktur: Gute Verkehrsanbindung, Bildungs- und Freizeitangebote steigern den Wert.
- Umweltfaktoren: Lärm- und Umweltbelastungen können den Kaufpreisfaktor mindern.
- Blick und Ausrichtung: Bei Wohnungen spielt auch die Ausrichtung (z. B. Sonnenseite) und der Blick eine Rolle.
Entwicklung des Kaufpreisfaktors in Deutschland
Die Kaufpreisfaktor-Entwicklung der letzten Jahre zeigt eine deutlich steigende Tendenz – insbesondere in Metropolregionen. Grund: Nachfrageüberhang, steigende Baukosten und niedrige Zinsen bis 2022 führten zu höheren Kaufpreisen, während Mieten langsamer stiegen.
- Durchschnittlicher Faktor in Großstädten: +25 % seit 2018
- In ländlichen Regionen: stabile bis leicht rückläufige Faktoren
- Renditen sinken – bewertungsbasierte Investitionsentscheidungen werden wichtiger
Häufige Fragen (FAQ) – Kaufpreisfaktor Immobilien
Was sagt der Kaufpreisfaktor aus?
Der Kaufpreisfaktor zeigt, wie viele Jahresnettokaltmieten erforderlich sind, um den Kaufpreis einer Immobilie rein rechnerisch zu refinanzieren. Er dient als schnelle Orientierung für Rendite und Preisniveau eines Objekts. Je niedriger der Faktor, desto höher ist in der Regel die laufende Bruttomietrendite. Wichtig: Der Faktor ersetzt keine Detailprüfung zu Lage, Zustand, Mietvertrag, Leerstandsrisiko und künftigen Instandhaltungskosten.
Was ist ein guter Kaufpreisfaktor?
Ein “guter” Kaufpreisfaktor hängt von Stadt, Mikrolage, Objektart und Zustand ab. In vielen Märkten gelten Bereiche von 15–25 als attraktiv für Wohnimmobilien, während Top-Lagen höhere Faktoren rechtfertigen. Faustregel: Niedriger Faktor = schnellere Amortisation, aber oft mit mehr Risiko oder Investitionsbedarf. Prüfen Sie stets CapEx, Mieterbonität und Mietentwicklung, statt nur den Faktor zu vergleichen.
Wie berechnet man den Kaufpreisfaktor?
Formel: Kaufpreis / Jahresnettokaltmiete. Beispiel: 600.000 € / 30.000 € = Faktor 20. Nutzen Sie realistische Ist-Mieten (oder belastbare Soll-Mieten) und schließen Sie Betriebskosten aus. Achten Sie auf Leerstand, Staffelmieten, Indexierung und Sonderfälle wie möblierte Vermietung. Für den Objektvergleich ist die einheitliche Datengrundlage entscheidend, damit Faktoren nicht “Äpfel mit Birnen” gegenüberstellen.
Was ist der Unterschied zwischen Kaufpreisfaktor und Mietrendite?
Die Bruttomietrendite ist der Kehrwert des Kaufpreisfaktors: Rendite (%) ≈ 100 / Faktor. Beispiel: Faktor 20 ≈ 5 %, Faktor 25 ≈ 4 %. Beachten Sie: Das ist brutto, ohne Bewirtschaftungskosten, Leerstand, Verwaltung und Rücklagen. Für Investitionsentscheidungen hilft zusätzlich die Nettomietrendite bzw. ein Ertragswert-/DCF-Ansatz, um Kosten und Risiken abzubilden.
Wie beeinflusst die Lage den Kaufpreisfaktor?
In A-Lagen mit hoher Nachfrage, guter Infrastruktur und geringen Leerständen sind die Faktoren tendenziell höher (geringere Rendite). B-/C-Lagen bieten oft niedrigere Faktoren (höhere Rendite), dafür meist mehr Risiko. Neben der Stadt zählen Mikrolage (Straße, Umfeld), Objektzustand, Baujahr und Nachfrage im Segment (z. B. kleine Wohnungen) stark für den realistischen Faktor.
Was ist der Kaufpreisfaktor bei Gewerbeimmobilien?
Gewerbeimmobilien liegen häufig im Bereich 15–25, variieren jedoch stark nach Nutzungsart, Vertragslaufzeit, Indexierung, Lage und Mieterbonität. Sicherere Cashflows (langfristige Verträge, Ankermieter, zentrale Lagen) können höhere Faktoren rechtfertigen, Spezialnutzungen oder kürzere Laufzeiten eher niedrigere Faktoren. Prüfen Sie daher Leerstandsrisiko, Umnutzungsfähigkeit und Marktzyklen besonders genau.
Was bedeutet Kaufpreisfaktor-Entwicklung?
Die Kaufpreisfaktor-Entwicklung beschreibt, wie sich das Verhältnis von Kaufpreis zu Mieteinnahmen über die Zeit verändert. Treiber sind u. a. Zinsen, Baukosten, Einkommens- und Bevölkerungsentwicklung, Neubauangebot und Regulierung. Phasen günstiger Finanzierung führten historisch oft zu steigenden Faktoren, Zinswenden oder schwächere Nachfrage eher zu sinkenden Faktoren. Daten immer stichtagsbezogen betrachten.
Was ist ein Vervielfältiger bei Immobilien?
“Vervielfältiger” ist ein gängiges Synonym für den Kaufpreisfaktor, besonders im Ertragswertverfahren. Er setzt den Kaufpreis ins Verhältnis zur Jahresnettokaltmiete und ermöglicht schnelle Vergleiche zwischen Objekten und Märkten. In Gutachten und Wertermittlungen wird der Begriff häufig genutzt, seine Interpretation folgt jedoch stets dem konkreten Bewertungsansatz und den Marktdaten.
Wie kann ich den Kaufpreisfaktor sinnvoll nutzen?
Nutzen Sie den Faktor zum Screening und für Vergleiche zwischen Objekten und Städten. Ergänzen Sie ihn stets um CapEx-Planung, Mieterbonität, Restlaufzeiten, Leerstandsrisiko, Mietentwicklung und Standortqualität. Für Entscheidungen sind Nettorendite und Cashflow-Modelle (z. B. DCF) aussagekräftiger. So vermeiden Sie Fehlinterpretationen, die durch reine Betrachtung des Kaufpreisfaktors entstehen.
Wo finde ich aktuelle Kaufpreisfaktoren?
Verlässliche Quellen sind Marktberichte (z. B. VON POLL IMMOBILIEN), Gutachterausschüsse, offizielle Statistikportale und Research-Publikationen. Prüfen Sie Stichtag, Definition (brutto/netto) und Segment (Wohnung, MFH, Büro, Handel), damit Angaben vergleichbar bleiben. Für konkrete An- oder Verkäufe empfiehlt sich eine individuelle Standort- und Objektanalyse auf Basis aktueller Transaktionsdaten.
Fazit
Der Kaufpreisfaktor ist ein unverzichtbares Werkzeug für Investoren, die den Markt realistisch bewerten möchten. Er schafft Transparenz über Rentabilität und Risiko – insbesondere im Vergleich verschiedener Städte oder Objekttypen.
Wer fundierte Entscheidungen treffen will, sollte den Faktor mit professioneller Bewertung und Marktdaten kombinieren. VON POLL IMMOBILIEN unterstützt Sie dabei mit individuellen Standortanalysen und Expertenwissen aus erster Hand.